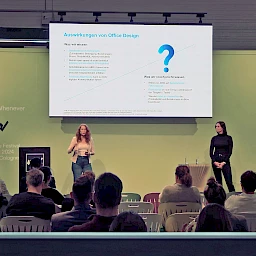Die neue Reihe „Die Raumdenkerinnen“ für das IBA Forum von Amelie Marie Fischer (Universität Konstanz) und Dr. Ann Sophie Lauterbach (Technische Universität Dresden) gibt im September 2025 Einblicke in die Forschung zur räumlichen Gestaltung der Arbeitswelt von der weltweit größten Managementkonferenz in Kopenhagen.
Warum reden wir heute (wieder) über Räume?
Kaum ein Thema bewegt Unternehmen derzeit so sehr wie die Frage: Wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten – und wo? In den letzten Jahren sind mehrere Entwicklungen zusammengekommen, die das Thema Raum neu aufgeladen haben:
- Hybride Arbeit hat viele der bisherigen Raumkonzepte obsolet gemacht. Wenn ein Großteil der Belegschaft regelmäßig mobil arbeitet, stellt sich die Frage: Wofür brauchen wir das Büro noch – und wie muss es dafür gestaltet sein?
- Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erfordern eine kritische Auseinandersetzung mit Flächenverbrauch, Gebäudebestand und Ressourceneinsatz. Weniger ist oft mehr – aber wie ohne kulturellen Verlust?
- Employer Branding und Wohlbefinden: Mitarbeitende wünschen sich heute nicht nur funktionale, sondern auch atmosphärisch ansprechende, gesunde und inklusive Arbeitsumgebungen. Der Raum wird zum Ausdruck organisationaler Werte und Attraktivität.
Spätestens in der Corona-Pandemie haben viele Organisationen bemerkt, dass Raum nicht nur ein physisches Setting ist, sondern eine zentrale Bedeutung für Kultur, Zusammenarbeit und Identifikation hat. Gleichzeitig stehen Organisationen unter dem Druck, Flächen zu reduzieren, Energiekosten zu senken und hybride Modelle funktional wie sozial tragfähig zu gestalten. Raum ist also zurück auf der Managementagenda, aber anders als früher: nicht mehr nur als Frage der Ausstattung, sondern als strategischer Faktor der Organisationsgestaltung.
Was ist „Organizational Space“?
In der Managementforschung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein eigenes Forschungsfeld etabliert, das sich mit der Bedeutung von Raum in Organisationen beschäftigt: Organizational Space. Der Begriff unterscheidet sich bewusst von „Architektur“ oder „Workplace Design“, da er Raum nicht primär als gebaute Umgebung, sondern als sozial konstruierte, dynamische und bedeutungsgeladene Struktur versteht. Bereits frühe philosophische Perspektiven bieten spannende Ansätze, die noch heute in der Managementforschung nachwirken.
Henri Lefebvre beschrieb schon 1974 Raum als Produkt sozialer Praktiken. Er argumentierte, dass Räume nicht nur Kulisse sind, sondern durch die Art und Weise, wie sie genutzt, gedacht und geplant werden, ständig neu entstehen. Michel Foucault lenkte den Blick zudem auf die Machtverhältnisse, die in Räumen eingeschrieben sind. Wer kontrolliert den Zugang? Wer sieht wen? Wer kann sich zurückziehen? Raum ordnet – und damit auch Hierarchie und Verhalten. Schließlich gibt es in der Forschung auch die Unterscheidung zwischen space und place (u. a. Yi-Fu Tuan, 1975; Tim Cresswell, 2014), die betont, dass erst durch subjektive Bedeutung aus einem neutralen Raum ein bedeutungsvoller Ort wird. Ein Schreibtisch wird erst zum „eigenen Platz“, wenn emotionale Bindung, Routinen und soziale Beziehungen ihn prägen.
Was gehört denn alles zu diesen Spaces?
Diese Debatten finden nicht nur in der Theorie statt, sondern auch auf wissenschaftlichen Konferenzen. Auf der weltweit größten Managementkonferenz Academy of Management, die dieses Jahr im trendigen Kopenhagen stattfand, nahmen diese Themen neben (und mit) technologischem Wandel einen sehr präsenten Platz ein. Wissenschaftler:innen und Unternehmensvertreter:innen besprachen dabei nicht nur das Büro, sondern alle möglichen in-between spaces. Und damit meinen wir wirklich alles: vom altehrwürdigen Headquarter bis zum nomadischen Lifestyle auf Bali. Dazu gehören das Arbeiten in Coworking und Coliving Spaces, mobiles Arbeiten in öffentlichen Bereichen wie Cafés oder zu Hause sowie auch, ganz klassisch, die Büroarbeit.
Organisationswissenschaftler:innen untersuchen dabei wie Raum durch Möglichkeiten (Cnossen und Bencherki, 2019; Weinfurtner und Seidl, 2019), Atmosphären (Beyes und Steyaert, 2012; Petani und Mengis, 2016) und Anordnungen (Beyes und Holt, 2020) die Dynamik von Beziehungen und Organisationen sowohl widerspiegelt als auch prägt. Sicher sind wir uns darin, dass Räume gemeinsam geplant und belebt werden müssen, und zwar nicht nur einmalig, sondern auch mit kontinuierlichen Anpassungen, so wie sich eben auch eine Organisation, ihre Ziele und Belegschaft weiterentwickeln. Raum ist eben nicht fix, es dreht sich um eine Struktur, die kontinuierlich, durch alltägliche Praktiken, genutzt, erlebt und verhandelt wird. Ein Raum ohne Menschen, die ihm Bedeutung verleihen, bleibt leblos. Erst durch die Zuschreibung von Sinn und die soziale Interpretation verwandelt er sich vom physischen Gebilde in einen psychologischen Ort voller Symbolik. Nun aber genug philosophiert!
Welche Fragen stellt die Forschung?
Die Frage ist ganz klar nicht mehr, ob Raum wirkt, sondern wie, wann und für wen. Dabei kommen beispielsweise folgende Forschungsfragen auf:
1. Wie verändert die Flexibilität der Arbeit Raum- und Zeitressourcen?
Untersuchungen zeigen, dass neue Raum-Zeit-Kopplungen entstehen: Nicht mehr alle sind gleichzeitig vor Ort, Flächen werden geteilt, Präsenz wird strategisch – und das verändert Sichtbarkeit und Teilhabe.
2. Wie wirken Raumkonzepte auf Teamdynamik und Führung?
Studien deuten darauf hin, dass offene, flexible Räume zwar den Austausch fördern können – aber nur, wenn gleichzeitig Rückzugsorte und klare Nutzungsregeln vorhanden sind. Für Führungskräfte ergibt sich daraus die Herausforderung, Räume (physisch wie digital) nicht lediglich zu verwenden, sondern sie aktiv und gemeinsam zu gestalten.
3. Inwiefern lässt sich Raum als strategisches Steuerungsinstrument nutzen?
Raumgestaltung kann Verhalten beeinflussen: Transparenz fördern, Begegnung ermöglichen, Silos aufbrechen. Gleichzeitig birgt sie Risiken, wenn Kontrolle und Rationalisierung dominieren.
Praxisfazit: Raum als Brücke zwischen Strategie, Kultur und Arbeitsrealität
Ein zentrales Fazit aus der aktuellen Forschung: Räume sind nie nur funktionale Behälter, sie sollten achtsam und reflektiert gestaltet werden. In Zeiten von technologischer Transformation und Fachkräftemangel wird Raum zur Brücke zwischen strategischen Zielen (Effizienz, Flexibilität), kulturellen Werten (Vertrauen, Beteiligung) und konkreter Arbeitsrealität (Tools, Zusammenarbeit, Wohlbefinden). Raum ist nicht nur Kostenfaktor, sondern Steuerungsinstrument, kulturelle Ressource und Kommunikationsträger. Räume sind gelebte Organisation: Sie ordnen, verbinden, trennen, symbolisieren. Sie formen, wie sich Menschen in der Organisation verorten – sozial und emotional. Daher wird klar: Raumgestaltung ist weit mehr als Architektur – sie ist gelebte Organisationsgestaltung.
Was erwartet Sie in dieser Reihe?
Es ist kein Kinderspiel, unter zunehmender örtlicher und zeitlicher Fluidität individuelle Bedürfnisse mit kollektiven Zielen zusammenzubringen. In den kommenden Beiträgen der IBA-Forschungsreihe „Die Raumdenkerinnen“ bieten wir verschiedenste Impulse und widmen uns praxisrelevanten Fragen zur Gestaltung von Arbeitsräumen:
- Wie wirken unterschiedliche Bürodesigns tatsächlich auf Mitarbeitende?
- Was bedeutet Flexibilität in Zeiten von Homeoffice und Caféarbeit?
- Wie kann in digitalen Räumen ein Wir-Gefühl entstehen?
- Wie können physische Räume inklusiv gestaltet werden?
- Welche Rolle spielen Status und Macht in Raumgestaltung?
- Und wie lässt sich überhaupt messen, ob eine Raumgestaltung „funktioniert“?
Dabei kombinieren wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Handlungsempfehlungen für Praktiker:innen. Klingt spannend, oder? Bleiben Sie dran, wir freuen uns darauf!




 IBA Forum-Gastbeitrag
IBA Forum-Gastbeitrag