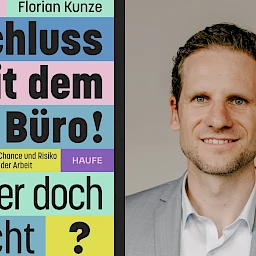Dr. Jo Aschenbrenner ist promovierte Rechtsanwältin, Coach und Autorin des Buches For Purpose. Ein neues Betriebssystem für Unternehmen. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit der Frage, wie Organisationen Sinn als gestaltendes Prinzip verankern können. Im Gespräch mit dem IBA Forum erläutert sie, warum Purpose weit mehr ist als ein Kommunikationsinstrument und welche strukturellen Voraussetzungen nötig sind, damit er in der Praxis wirkt.
In den letzten Jahren wurde viel über den Purpose von Unternehmen gesprochen. Welche Entwicklung beobachten Sie? Wird er heute eher strategisch oder emotional gelebt?
Ich finde es wichtig, den Begriff immer im Kontext des Organisationsparadigmas zu betrachten. Frederic Laloux hat dies in seinem Modell unterschiedlicher Unternehmenslogiken sehr schön beschrieben: von der leistungsorientierten orangefarbenen Organisation über die grüne gemeinschaftsorientierte, pluralistische bis hin zur petrolfarbenen integralen Purpose-Organisation. Viele große Unternehmen, also die klassischen orangefarbenen Organisationen, haben den Begriff „Purpose“ eher als Kommunikationsinstrument genutzt. Das war oft nur ein Purpose-Washing. In der grünen Logik, wie man sie häufig im Mittelstand findet, spielt Sinn dagegen schon eine größere Rolle, etwa als emotionales Commitment. Die integrale Organisation, die ich in meinem Buch beschreibe, geht jedoch noch einen Schritt weiter: Hier ist Purpose das zentrale Ordnungsprinzip, aus dem sich Strukturen, Entscheidungen und Führung ableiten. Was die öffentliche Berichterstattung über Purpose angeht, hat sich nach dem ersten Hype in den sozialen Medien heute vieles wieder normalisiert. Die meisten Unternehmen sind zu klassischeren Führungsformen zurückgekehrt, da sie die Offenheit und Selbstorganisation nicht aufrechterhalten konnten. Gleichzeitig wächst aber eine kleine, sehr konsequente Gruppe von Unternehmen, die Purpose wirklich strategisch verankert. Dort gilt: Profit follows Purpose.
Wie kann es gelingen, Purpose tatsächlich zu verankern?
Echter Wandel beginnt bei den Strukturen. In meiner Arbeit mit encode.org haben wir uns unter anderem die folgenden Fragen gestellt: Wem gehört das Eigentum am Unternehmen? Wer ehat Entscheidungsgewalt? Wer profitiert vom Kapital? Nur wenn Eigentum, Stimmrechte und Kapitalströme ebenfalls mit dem Zweck des Unternehmens vereinbar sind, kann dieser wirksam werden. So haben wir beispielsweise beschlossen, dass es keine klassischen Arbeitnehmer mehr geben darf, sondern nur Mitunternehmer. Auch andere Organisationen, wie die spanische Firma Krisos, zeigen, was passiert, wenn man diesen Weg konsequent geht: 50 % Umsatzwachstum, 0 % Fluktuation, 100 % Gehaltstransparenz und ein deutlich höherer Frauenanteil in Führungspositionen. Das sind keine Zufälle, sondern Ergebnisse konsequenter Strukturveränderungen. Purpose lässt sich nicht einfach implementieren. Organisationen müssen so aufgebaut werden, dass sie nicht anders können, als sinnorientiert zu handeln.
Oft ist von einem Powershift die Rede, also einer neuen Verteilung von Verantwortung, Macht und Entscheidungsgewalt. Was ist nötig, damit dieser Wandel gelingt?
Zunächst braucht es Menschen, die bereit sind, Macht neu zu leben. Powershift bedeutet: Mal führe ich, mal werde ich geführt – je nach Aufgabe. Führung ist keine Position mehr, sondern eine Funktion. Das setzt voraus, dass ich meinen Selbstwert nicht aus einer Führungsrolle beziehe und dass ich in Führung hineinwachse, wenn ich vorher geführt wurde. Zweitens sind Systeme erforderlich, die klar regeln, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. Nur so entstehen Transparenz und Vertrauen, auch gegenüber Kunden. Und drittens muss der rechtliche Rahmen passen. Wenn Eigentum, Stimme und Verantwortung auseinanderfallen, bleibt letztlich alles beim Alten. Purpose verlangt nach einem neuen Rechts- und Führungsverständnis.
Wie verändert sich Führung in einer Purpose-driven Organization, insbesondere in einer hybriden, digitalisierten Arbeitswelt?
In integralen Organisationen wie encode.org ist Führung vollständig von personengebundenen Hierarchien entkoppelt. Es gibt keine Chefs, sondern rollenbasierte, aufgabenbezogene Verantwortung. Jeder führt dort, wo er oder sie fachlich kompetent ist und die jeweilige Aufgabe übertragen bekommen hat. Das funktioniert jedoch nur, wenn Klarheit über die Zuständigkeiten herrscht. Empathie und psychologische Sicherheit sind zwar wichtig, jedoch kein Führungsauftrag. Jeder Mensch ist selbst dafür verantwortlich, in dieser Struktur Stabilität zu finden und die Ziele der Organisation voranzutreiben. Das mag radikal klingen, ist aber unglaublich befreiend, weil jeder genau weiß, woran er ist. Führung bedeutet hier: Eigenverantwortung übernehmen, nicht Kontrolle ausüben.
Wie passt dieses Verständnis zu den Erwartungen der jüngeren Generationen, die häufig nach Sinn und Selbstwirksamkeit suchen?
Ich glaube, die Generation Z ist viel differenzierter, als sie oft dargestellt wird. Viele junge Menschen wünschen sich nicht nur Sinn, sondern auch klare Strukturen und Sicherheit. Sie wollen wissen, was von ihnen erwartet wird, und sich innerhalb dieses Rahmens entfalten. Organisationen müssen diesen klaren Rahmen bieten und gleichzeitig Raum für Entwicklung lassen. Das heißt: Erwartungen klar kommunizieren, Leistungsbereitschaft einfordern, aber auch zuhören und Talente fördern. Sinn entsteht, wenn Verbindlichkeit und Selbstentfaltung zusammenkommen.
Sie plädieren dafür, New Work mit klaren Rahmenbedingungen zu verbinden. Wo liegt das richtige Maß zwischen Freiheit und Struktur?
New Work scheitert, wenn es keine Regeln gibt. Modelle wie Holacracy oder Soziokratie schaffen nicht weniger, sondern mehr Hierarchie, nämlich rollenbezogene. Entscheidungen müssen nachvollziehbar und transparent getroffen werden. Erst wenn alle die Regeln kennen, entsteht echte Freiheit. In solchen Systemen gibt es völlige Transparenz: Aufgaben, Gehälter und Finanzen sind für alle einsehbar. Vertrauen entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Offenheit. Das ist die Basis von Verantwortung.
Wenn Sie fünf Jahre vorausblicken: Welche Art von Organisationen werden wir dann sehen?
Ich glaube, dass sich in fünf Jahren gar nicht so viel verändern wird. Die klassischen Konzerne werden ebenso weiter existieren wie Unternehmen, die Purpose eher kommunikativ verstehen. Daneben wird es eine kleine, aber wachsende Gruppe integraler Organisationen geben, vielleicht 0,1 % weltweit. Echter kultureller Wandel braucht Zeit. Wir sprechen hier von Generationen, nicht von Quartalen. Aber ich bin überzeugt: Diese Pioniere zeigen, was möglich ist, und werden langfristig Maßstäbe setzen.
Zum Schluss: Was ist Ihr persönlicher Purpose?
Mein Purpose ist es, Menschen in ihrer Selbstwahrnehmung, ihrer Entwicklung und ihrer Verantwortung zu stärken. Ich glaube fest daran, dass Organisationen nur dann wachsen, wenn die Menschen in ihnen wachsen. Das ist der rote Faden in allem, was ich tue.
Frau Dr. Aschenbrenner, vielen Dank für das Gespräch.