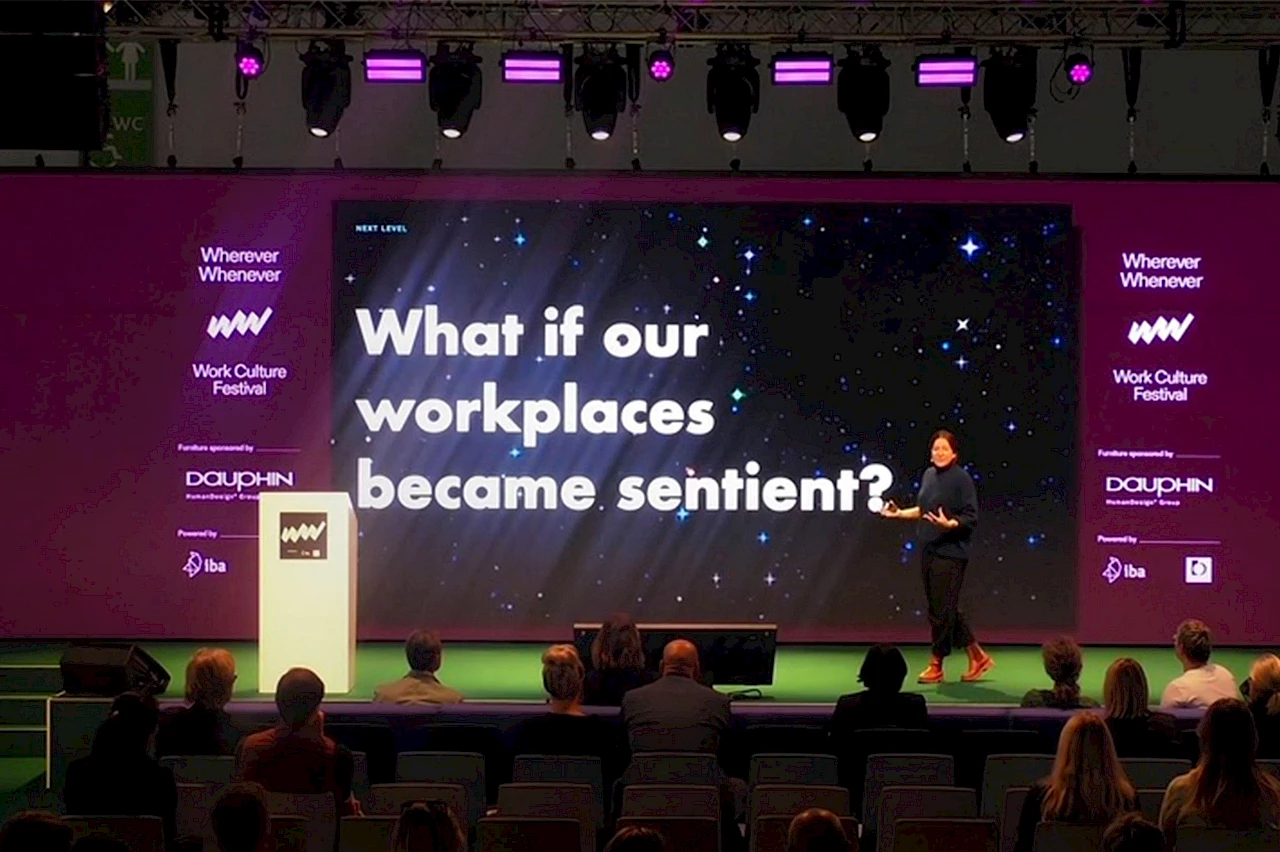„Technology will move off the screen and become the invisible engine that powers the real world around us.“ Mit dieser Vision eröffnete Sophie Kleber, UX Lead bei Google und Expertin für ethische KI und zukünftige Mensch-Maschine-Interaktion, ihre Keynote auf dem Work Culture Festival. Ihr Vortrag skizzierte, wie Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert, sondern auch, wie unsere Arbeitsumgebungen gestaltet werden, hin zu sogenannten neuroadaptiven Räumen, die auf unsere Bedürfnisse reagieren und aktiv unser Wohlbefinden steigern.
Vom starren Büro zum einfühlsamen Raum
Kleber zeichnete das Bild einer Arbeitswelt, in der sich Räume aktiv an die Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen. Grundlage dafür sind intelligente, sensorbasierte Systeme, die über Licht, Temperatur, Luftqualität und andere Parameter das Arbeitsumfeld dynamisch gestalten. Der Arbeitsplatz wird so zum einfühlsamen Begleiter, der Produktivität und Erholung gleichermaßen unterstützt. Doch es geht nicht nur um technische Raffinesse, sondern um einen grundlegenden Perspektivwechsel: Räume werden zu aktiven Akteuren im Arbeitsalltag. Sie registrieren Stimmungen, erkennen Stresslevel und unterstützen durch gezielte Anpassungen das individuelle Wohlbefinden. Wer einen solchen Raum betritt, soll nicht einfach nur arbeiten. Er oder sie soll sich sofort willkommen fühlen, inspiriert werden und die richtige Atmosphäre für konzentriertes Arbeiten, kreative Zusammenarbeit oder gezielte Erholung vorfinden. Durch den Einsatz von KI und vernetzten Systemen entsteht eine neue Art von Arbeitsumgebung: flexibel, vorausschauend und menschenzentriert. Diese Räume reagieren nicht nur auf äußere Rahmenbedingungen, sondern auch auf die emotionale und kognitive Verfassung ihrer Nutzer. Ein echter Paradigmenwechsel.
Bausteine einer intelligenten Arbeitsumgebung
Ein zentrales Thema ihres Vortrags war die Bedeutung spezifischer Raumfaktoren für das emotionale und kognitive Wohlbefinden:
- Licht: Natürliches Tageslicht ist der stärkste Einflussfaktor auf das Wohlbefinden. Adaptive Lichtsysteme, die den circadianen Rhythmus berücksichtigen, sorgen für Aktivierung am Morgen und Entspannung am Nachmittag.
- Biophilie: Der Einzug der Natur ins Büro, sei es durch Pflanzen, begrünte Wände oder Ausblicke ins Freie, baut Stress ab, fördert die Kreativität und steigert das Zugehörigkeitsgefühl.
- Farben: Farben wirken nicht nur stimmungsaufhellend, sondern unterstützen auch gezielt kognitive Prozesse. Kräftige Farben wie Orange können anregen, Blau fördert Ruhe und Konzentration. Farben dienen auch als Branding-Element, um die Identität eines Unternehmens im Raum zu verankern.
- Luftqualität: Frische, saubere Luft ist elementar für Konzentration und Wohlbefinden. Moderne Gebäudetechnologien überwachen die Luftqualität kontinuierlich und sorgen für ein gesundes Arbeitsumfeld.
- Temperatur: Wohlfühltemperaturen sind individuell verschieden. Neuroadaptive Räume erkennen diese Präferenzen und passen das Klima automatisch an – ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung von Komfort und Leistungsfähigkeit.
- Soundscaping: Anstelle störender Hintergrundgeräusche schaffen intelligente Audiosysteme gezielt Klangwelten, die die Konzentration fördern oder soziale Interaktion unterstützen. Dazu gehört auch der bewusste Einsatz von akustischen Inseln für Deep Work oder kreative Zusammenarbeit.
- Scent (Duftgestaltung): Düfte haben einen großen Einfluss auf Emotionen und Konzentrationsfähigkeit. Ob belebende Aromen zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder beruhigende Düfte zur Entspannung: Eine gezielte Duftgestaltung kann die Arbeitsatmosphäre nachhaltig verbessern.
Die Persönlichkeit des Raumes
Ein weiterer Aspekt in Klebers Vortrag war das Konzept der Persönlichkeit des Raums. Räume werden nicht mehr nur als statische Hüllen verstanden, sondern als empathische Umgebungen mit eigenem Charakter und gezielten Interaktionsmöglichkeiten. Diese Räume fühlen nicht im wörtlichen Sinne, aber sie reagieren sensibel auf die physischen und emotionalen Zustände ihrer Nutzer. So kann ein Raum beruhigend und schützend wie ein Kokon wirken, ausgestattet mit sanften Lichtquellen, gedämpften Farben, weichen Materialien und angenehmen Düften, die Geborgenheit vermitteln und zum Entspannen einladen. In einer anderen Situation kann sich derselbe Raum in eine inspirierende Werkstatt verwandeln, in der kräftige Farben, belebende Aromen und eine aktivierende Lichtstimmung kreative Impulse setzen. Ebenso kann ein Raum als offenes, kommunikatives Forum mit flexibler Möblierung, klaren Sichtachsen und einladender Geräuschkulisse gestaltet sein.
Der notwendige Wandel im Planungsprozess
Um diese Vision zu realisieren, ist laut Kleber ein radikales Umdenken im Real-Estate- und Planungsprozess notwendig. Statt Architektur als abgeschlossene Disziplin zu betrachten, müsse der Mensch mit seinen sich wandelnden Bedürfnissen konsequent in den Mittelpunkt rücken. Gebäude dürfen nicht länger als starre Strukturen gedacht werden, sondern müssen flexibel, lernfähig und anpassungsfähig sein, um der dynamischen Arbeitswelt gerecht zu werden. Der Wandel beginnt mit der aktiven Einbindung der Nutzer: Arbeitsplatzbefragungen und kontinuierliches Feedback werden zum Steuerungsinstrument, um die tatsächlichen Bedürfnisse zu verstehen. Dabei geht es nicht nur um Raumgrößen oder Möblierung, sondern auch um die Frage, ob sich die Mitarbeiter emotional wohlfühlen und ob Rückzugs- und Begegnungsorte im richtigen Maß vorhanden sind.
Auch die physische Gestaltung folgt diesem neuen Denken: Möbel werden modular, Räume wandelbar, vom Rückzugsort am Vormittag zum Kreativraum am Nachmittag. Technologien wie mobile Trennwände, adaptive Licht- und Klimatechnik sowie intelligente Steuerungssysteme ermöglichen eine flexible Raumnutzung. Erst am Ende steht der eigentliche Bau, nachhaltig, nutzerorientiert und auf langfristige Veränderbarkeit ausgelegt. Der klassische lineare Ablauf Planen – Bauen – Einrichten – Fertig weicht einem iterativen Prozess: „Wir müssen Arbeitsräume wie Software denken – als Systeme, die sich ständig weiterentwickeln und anpassen“, so Kleber. Immobilien werden damit zu dynamischen Wertschöpfungsfaktoren und nicht mehr als starre Investitionsobjekte betrachtet; Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung werden zum zentralen Erfolgsfaktor zukunftsfähiger Arbeitswelten. Dieser Wandel erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Architektur, Technologie, HR und Unternehmensführung. Denn nur wenn alle Bereiche gemeinsam an einer humaneren und anpassungsfähigeren Arbeitsumgebung arbeiten, kann das volle Potenzial neuroadaptiver Räume für die Menschen, die sie täglich nutzen, ausgeschöpft werden.
Der Arbeitsplatz als aktiver Partner
Am Ende steht die Vision einer Arbeitsumgebung, die nicht nur funktional ist, sondern das menschliche Potenzial aktiv entfaltet. Neuroadaptive Räume begleiten den Menschen durch den Arbeitstag, unterstützen produktive Phasen, ermöglichen gezielte Erholung und fördern das Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Dabei agiert der Raum als unsichtbarer Partner, der die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer erkennt, darauf reagiert und so aktiv zu Gesundheit, Kreativität und Effizienz beiträgt.
Adaptivität geht dabei weit über technische Spielereien hinaus. Neuroadaptive Räume sind Ausdruck einer neuen Haltung: Der Arbeitsplatz wird als lebendiger Organismus verstanden, der mit seinen Nutzern interagiert, sie versteht und sie aktiv bei der Entfaltung ihrer Potenziale unterstützt. Sophie Kleber schloss ihre Keynote mit einem Zitat, das diesen Paradigmenwechsel auf den Punkt brachte: „Responsibly optimized neuro-adaptive architecture has the potential to elevate civilization to its most human level.“ Mit dieser Botschaft wurde deutlich: Die Zukunft der Arbeitswelt liegt nicht in einem Mehr an Technologie, sondern in einer intelligenten, empathischen Gestaltung unserer physischen Umgebung. Im Dienst der Menschen, ihrer Bedürfnisse und ihrer Potenziale.