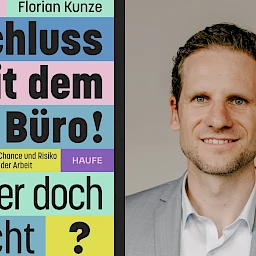Räume prägen, wie wir uns fühlen, miteinander kommunizieren und uns unseren Aufgaben widmen. Doch was bewirken verschiedene Bürodesigns tatsächlich? Und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse helfen, Raumentscheidungen besser zu treffen?
RÄUME IM WANDEL
Die Gestaltung von Büros hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Einzelbüros verschwinden, offene Flächen und flexible Arbeitsplatzkonzepte werden zum Standard. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass räumliche Offenheit Kreativität, Kommunikation und Gemeinschaft fördert.
Räume wirken – nur nicht immer so wie beabsichtigt. Offenheit kann Zusammenarbeit erleichtern, aber auch zu Ablenkung, Stress und einem Gefühl ständiger Beobachtung führen. Gleichzeitig zeigen Studien, dass das klassische Einzelbüro zwar Konzentration ermöglicht, jedoch spontane Begegnungen und informellen Austausch erschwert. Kein Modell ist also per se besser, entscheidend ist die Passung zwischen Raum, Tätigkeit und Kultur.
Entsprechend richtet sich der Blick der Forschung zunehmend darauf, wie Bürodesign tatsächlich wirkt: Welche Effekte haben Open Spaces auf Zufriedenheit und Zusammenarbeit? Was leisten aktivitätsbasierte Büros (ABOs) wirklich? Die folgenden Forschungsergebnisse geben darauf erste Antworten und zeigen, wie komplex das Zusammenspiel von Raum, Arbeit und Organisation ist.
WIE RÄUME WIRKEN
Wie stark Bürogestaltung auf den Körper wirkt, zeigt eine aktuelle systematische Review von Schuller et al. (2025). Die Forschenden haben 33 empirische Studien ausgewertet, in denen messbare Stressreaktionen untersucht wurden, wie etwa Herzratenvariabilität, Hautleitfähigkeit oder Cortisolwerte. Das Ergebnis: Die Bürogestaltung beeinflusst nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern auch, wie unser Körper reagiert. Als besonders wirksam erwiesen sich natürliche Elemente. Pflanzen, Blumen und Ausblicke ins Grüne senkten messbar die physiologische Stressaktivierung. Entscheidend war dabei das Maß: Ein moderater Anteil an Begrünung (rund 8 bis 12 % der Sichtfläche) wirkte entspannend, zu viel Grün dagegen überforderte. Untersuchungen zu Holzoberflächen zeigten dagegen kein einheitliches Bild: In der Hälfte der Fälle (56 %) wurden teilweise stressreduzierende Effekte beobachtet, ein Drittel der Ergebnisse zeigte keine Wirkung und etwa 11 % sogar stresssteigernde Reaktionen, insbesondere in dunkleren Holzräumen. Unterschiede zwischen offenen, halboffenen und geschlossenen Büros blieben ebenfalls uneindeutig. Duftreize wie ätherische Öle wirkten sehr individuell: Was manche entspannte, erhöhte bei anderen den Puls. Subtile und atmosphärische Raumqualitäten, etwa wie „natürlich“, „entspannend“ oder „heimisch“ ein Raum erlebt wird, wurden bislang kaum berücksichtigt, ebenso wenig die vermittelnde Rolle sensorischer Wahrnehmung über verschiedene Sinneskanäle hinweg.
Forschung zum sogenannten biophilen (naturnahen) Design zeigt, dass die angemessene Kombination aus visuellen und auditiven Naturelementen, die sowohl das Arbeitsgedächtnis stärkt als auch physiologische Stressreaktionen reduziert, besonders effektiv wirkt. Um diese Wirkung zu erreichen, braucht es allerdings mehr als ästhetische Intuition. So spricht die Umweltpsychologin Sally Augustin von „Design with Science“ – einer Gestaltung, die psychologische Erkenntnisse nutzt, statt sich auf Trends zu verlassen. Farben, Licht, Akustik und Materialien wirken messbar auf Konzentration, Kommunikation und Erholung. Wer wissenschaftlich gestaltet, kann Räume gezielt auf verschiedene Tätigkeiten abstimmen: Warme Lichtzonen fördern Entspannung, kühle Farbtöne Fokus, natürliche Materialien das Gefühl von Zugehörigkeit.
Wie offen darf ein büro sein?
Eine weitere systematische Literaturübersicht von Gerlitz und Hülsbeck (2023) hat 46 empirische Studien zu den drei dominanten Büroformen ausgewertet: Einzelbüro, Open Plan Office und aktivitätsbasiertes Büro (ABO). Das Ergebnis fällt überraschend eindeutig aus: Das klassische Einzelbüro ist die produktivste Arbeitsumgebung, insbesondere für wissensintensive Tätigkeiten. Während offene Büros häufig mit geringeren Flächenkosten und mehr Austausch begründet werden, zeigen die Daten, dass sie in der Praxis oft einen Produktivitätszoll kosten. Ablenkung durch Lärm, mangelnde Privatsphäre und eingeschränkte Kontrolle über den Arbeitsplatz mindern Leistung, Zufriedenheit und Gesundheit. ABOs, also die flexible Nutzung verschiedener Arbeitszonen im offenen Büro, liegen zwischen beiden Polen: Richtig umgesetzt können sie Zufriedenheit und Konzentration fördern, doch das erfordert eine durchdachte Organisation von Zeit, Raum und Teamprozessen. Ohne klare Regeln und Managementunterstützung drohen auch hier Orientierungslosigkeit und Produktivitätsverlust.
Eine aktuelle Metaanalyse unseres Teams von 36 Studien mit fast 8.000 Beschäftigten zeigt: ABOs fördern die Bewegung und Zusammenarbeit mehr als andere Bürokonzepte. Beschäftigte wechseln häufiger den Arbeitsplatz, sind körperlich aktiver und haben mehr Kontakt zu Kolleg:innen. Allerdings zeigt die wahrgenommene Kontrolle über den Arbeitsplatz – das Steckenpferd dieses Designs – in den verschiedenen Studien keinen Effekt. Besonders interessant sind die Kontextunterschiede: Im Privatsektor zeigen ABOs deutlich positivere Effekte als im öffentlichen Sektor. So zeigen Umstellungen in privaten Organisationen einen Anstieg der wahrgenommenen Produktivität, während die Mitarbeitenden in öffentlichen Organisationen nicht nur von einem Rückgang der Produktivität, sondern auch von schlechteren Beziehungen zu Kolleg:innen und Führungskräften sowie geringerem Autonomieempfinden berichten. Unabhängig vom Sektor verlaufen auch jene Umstellungen erfolgreicher, die von offenen Büros zu aktivitätsbasierten Büros ausgelegt sind. Wer dagegen vom Einzelbüro wechselt, zeigte einen höheren Rückgang der Arbeitszufriedenheit. Entscheidend ist also nicht nur das Raumkonzept selbst, sondern wie und wo es umgesetzt wird.
Was folgt daraus für die praxis?
Letztlich bleibt entscheidend, wie Räume eingeführt und weiterentwickelt werden. Eberhardt und Lauterbach (2024) zeigen in einem Pilotprojekt zu aktivitätsbasierten Büros bei IWC Schaffhausen, dass Gestaltung ein fortlaufender Lernprozess ist: ausprobieren, beobachten, anpassen. Erst die Nutzung offenbart, was im Alltag wirklich funktioniert. Regelmäßige Tests und Anpassungen helfen, Raumkonzepte gezielt weiterzuentwickeln. Gute Gestaltung entsteht also dort, wo Mitarbeitende aktiv beteiligt werden, Feedbackschleifen fest verankert sind und sich Raumlösungen gemeinsam mit der Organisation weiterentwickeln.
Die Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zeigen: Wirksame Raumgestaltung entsteht dort, wo Raum, Tätigkeit und Kultur gemeinsam gedacht werden. Veränderung gelingt dann, wenn neue Raumkonzepte nicht nur im Design umgesetzt, sondern in den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur eingebettet werden. Räume entfalten Wirkung, wenn Mitarbeitende verstehen, wofür sie gedacht sind und sie aktiv mitgestalten können.
Haben Sie sich in dieser Folge der Raumdenkerinnen-Kolumne gefragt, wo denn dabei das Homeoffice bleibt? Das haben wir natürlich nicht vergessen – in der nächsten Ausgabe wird es darum gehen, wie hybride Arbeit und flexible Arbeitszeitmodelle räumliche Ordnungen verändern. Stay tuned!




 IBA Forum-Gastbeitrag
IBA Forum-Gastbeitrag