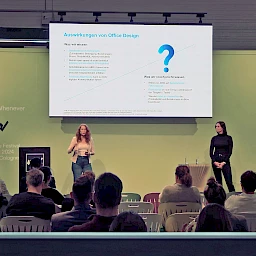Künstliche Intelligenz verändert zunehmend Prozesse und Strukturen der Wissensarbeit. In ihrer aktuellen „New Work Order“-Studie analysiert die Trendforscherin Birgit Gebhardt die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Kollaborationsformen, Arbeitsorganisation und die Gestaltung von Büro- und Lernumgebungen. Im Interview gibt sie Einblicke in ihren Forschungsansatz, zentrale Fragestellungen und erste Ergebnisse.
Du forschst seit Jahren zur Zukunft der Arbeit: Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, die Auswirkungen von KI auf Kollaboration zu untersuchen?
Weil die Künstliche Intelligenz jetzt die Office-Abläufe verändert. Mit KI lassen sich Business-Prozesse (z. B. IBM, SAP) in deren Cloud sinnvoll vernetzen oder automatisieren. Auch erleben wir gerade, wie zahlreiche Office-Tool-Applikationen (z. B. Microsoft) mit uns kommunizieren, Wissen dokumentieren und beginnen, inhaltlich quasi mitzudenken. Dieser Performance-Boost wird eine neue Dynamik in das vernetzte Miteinander bringen, und ich würde gern wissen, wie diese Effizienz in unserer Zusammenarbeit konkret erlebbar wird.
Was macht deine Studie anders als andere KI-Studien?
Mein Fokus ist nicht der Performance-Boost durch die KI, der klar auf der Hand liegt. Mich interessiert, wie sich die Unternehmensleistung entwickelt, wenn die KI selbst quasi Standard geworden ist, und der Mensch wieder den Unterschied macht. Wer wird dann wie und wo zusammenarbeiten, um Performanz, Innovation und Wettbewerbsvorteil zu generieren? Dazu katapultiere ich mich quasi in die Zukunft und frage, wie die Kollaboration wohl funktioniert, wenn die KI unsere Unternehmensprozesse transformiert hat und KI-Agenten uns beruflich wie privat ganze Arbeitsprozesse abnehmen: Wie interagieren wir dann mit der KI – und wie miteinander?
Welche Erkenntnisse oder Perspektiven erwarten die Leser?
Mich beschäftigt die Weiterentwicklung der Wissensarbeit in der Organisation – gepusht durch die Einbeziehung der KI. Ein Ziel ist, herausfinden, wie der Einzug der KI die menschliche Wissensarbeit in Abteilungen, in Workflows oder der Wertschöpfungskette verändert. An welchen Stellen bleibt menschliches Zutun unerlässlich, und wie verändert sich dort die Zusammenarbeit? Wie anders generieren wir zukünftig Wissen und teilen es miteinander? Ein weiterer Forschungsfokus liegt in der Nutzerzentrierung. Als Trendforscherin frage ich immer nach dem Benefit für den Endkunden oder Anwender, und der ergibt sich mit KI aus dem vereinfachten Zugang zu Wissen, Lösungswegen, Übersetzungen und Darstellungsformaten. Hier interessiert mich, wie sich unsere User Experience durch die Kollaboration mit KI verändert – für die iterativen Schritte mit der KI und die interaktiven miteinander: Welche neuen Arbeitsrealitäten, Simulationen und Interaktionsformate verändern die Zusammenarbeit? Und welche der dafür nötigen Erfordernisse könnten dem Büro eine neue Richtung weisen?
Du skizzierst im ersten Teil der Studie Entwicklungspotenziale für die Wissensarbeit: Wo siehst du die spannendsten Einsatzfelder von KI für Wissensarbeit und Lernen?
Da wäre zum einen die assistierende Unterstützung und adaptive Wissensvermittlung zu nahezu allen Fragestellungen. Durch die quasi natürliche Dialogfähigkeit können Wissensgewinnung und Wissensanwendung situativ und spontan erfolgen, und über Monitoring mit der eigenen Interaktion in Echtzeit getrackt, kommentiert, geteilt und justiert werden. Das Sofort-Feedback der KI kann Handlungen in bewusste Erfahrungen verwandeln und so den individuellen Lernerfolg steigern. Das gilt auch für Lernerfahrungen im Team.
Wie verändert sich die Kommunikation im Büro?
Sie erfolgt schneller und einfacher, weil die Übersetzungsschritte in Arbeitsformate oder zu Software-Applikationen entfallen. Auch lassen sich Erledigungen an Agenten delegieren, die mehrere Arbeitsaufträge und Prozessschritte selbstständig verfolgen. Dadurch, dass die KI uns und unsere Arbeitsaufgaben mit zunehmender Wahrscheinlichkeit richtig interpretiert, können wir unsere Kommunikation freier, direkter und inhaltsgetriebener führen.
Und wie verändert KI das Miteinander in Teams?
Auch hier können LLMs und Darstellungstools die Verständigung unter stark gemischten Teammitgliedern erleichtern. Dadurch, dass wir mit der KI quasi wie mit einem Menschen sprechen können, erscheint sie uns wie ein vollwertiges Teammitglied, das es vielfach besser weiß und daher immer öfter miteinbezogen wird. Vor allem aber liefert KI ad hoc die nötigen Informationen aus Recherchen, Backoffice oder Customer Journey und kann den Lösungsprozess um valide Daten und risikominimierende Simulationen anreichern. Die Teams initiieren, flankieren und prüfen zunehmend die Arbeitsergebnisse der KI, indem sie die Parameter, Strategien und Ziele definieren, Unternehmensinteressen mit Kundenvorteilen in Einklang bringen und ihrem Forschungsdrang samt schöpferischer Neigung wieder mehr Raum geben. Dafür bleibt das Konzept von agilen Teams wichtig, die mit KI noch leichter transdisziplinär kollaborieren können, um auf neue Ideen und Lösungen zu kommen. Eine gute Mischung aus Expertise und Kundenperspektive wäre wichtig, um vom Erfahrungsschatz aus dem Team und dem uns eigenen Gespür für Veränderung profitieren zu können.
Deine Studie analysiert Mensch-KI-Interaktionen: Welche neuen Arbeitsmuster brechen besonders stark mit traditionellen Teamstrukturen?
Je besser die KI im sinnvollen Vernetzen ganzer Lösungsschritte wird, umso mehr sind wir geneigt, sie erst mal machen zu lassen. Während die KI lernt, laufen wir Gefahr, Wissen zu vergessen und den Lösungsprozess weniger intensiv zu begleiten. Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, der das Leibniz-Rechenzentrum in München-Garching leitet, berichtet, dass heute schon die Supercomputer mit dem Quantenrechner autonom aushandeln, welcher Rechner welche Aufgabe der Wissenschaftler übernimmt. Und je mehr Prozessschritte die KI intern verteilt und bearbeitet, umso weiter wird sich die menschliche Arbeit an den Anfang der Fragestellung und die Ergebnisüberprüfung am Ende hin verteilen. Kranzlmüller sieht in der Überprüfung fragwürdiger KI-Ergebnisse eine der Hauptaufgaben zukünftiger Fachkräfte, die den Weg vom KI-Ergebnis zurückverfolgen und für die inhaltliche Beurteilung wie die Korrektur der KI mit entsprechend hohem Skill-Set ausgestattet sein müssen. Zudem wird der schnelle Output die Gruppendynamik erhöhen, kann für die Teamarbeit aber auch zum Nachteil werden: Zum einen dann, wenn das Team sich von der KI-Darstellung täuschen lässt, weil die Ergebnisformate so perfekt erscheinen, als wären sie fertig durchdacht. Zum anderen, wenn nur eine Person das KI-Ergebnis anzweifelt, sich aber nicht traut, allein gegen den Strom zu schwimmen, etwa weil das straffe Timing ein kritisches Hinterfragen kaum zulässt oder die entsprechende Kompetenz zur Lösung des Problems eh gerade nicht zur Verfügung steht. Alle, die ihre Arbeit darin sehen, etwas fertig zu machen, bekommen mit KI eine großartige Unterstützung. Bloß ist dieses Ergebnis in Zukunft nicht mehr das, was wir unter unserer Arbeit verstehen sollten.
Du gehst in der Studie auch auf neue Kriterien für die Arbeitsumgebung ein. Wie sehen Räume aus, die diese neue Form der Zusammenarbeit fördern?
Das ist abhängig von der Arbeitsabsicht und der Atmosphäre, die dafür zielführend ist. Schon vor Berücksichtigung der KI war klar, dass zu den funktionalen Rollen, die der Arbeitsraum unterstützen sollte, auch emotionale Trigger gehören, die bei den Teilnehmern das Interesse füreinander adressieren. Jetzt, wo Teams ihre Denkprozesse immer wieder zur Anreicherung mit KI unterbrechen, gilt es, die multisensorischen Effekte noch zu verstärken – was insbesondere das Büro als seine Aufgabe sehen sollte: Sinneseindrücke mit kognitiven Erfahrungen zu koppeln, um die Lernerfahrung und Kohäsion der Zusammenarbeit spürbar zu machen. Dabei steht das physische Büro heute in Konkurrenz zu digitalen Brillen, Videospielen und Metaversen, die unmittelbare Anwendungsumgebungen schaffen und Teamarbeit virtuell ermöglichen. Weil es in der physischen Büroumgebung aber kaum mehr möglich ist, alle Teamplayer zeitgleich vor Ort zu vereinen, sollte das Büro die multisensorische Integration für hybride Formate weiter ausbauen. Das heißt, dass die Zugeschalteten situativ und formal auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden vor Ort gebracht werden müssen bzw. sie sich zwischen den Anwesenden orientieren und navigieren können sollten, um sich als aktiver Teilnehmer zu fühlen. Ich denke, dass auch hier KI-gestützte Sensoren und Technikschnittstellen ein intensiveres Miteinander ermöglichen, was dann auch in der räumlichen Wahrnehmung nahtloser gestaltet werden müsste.
Lesen Sie auch

Wie gehst du methodisch vor?
Ich schaue, was sich außerhalb des Büroumfelds tut, wie sich Wissensarbeit generell verändert und welche technologischen Neuerungen ökonomisch und anwendungsorientiert Vorteile bedeuten. Dadurch, dass ich inzwischen seit zwölf Jahren zur Zukunft der vernetzten Arbeitskultur forsche und berate, fallen mir einerseits schnell neue Muster auf und andererseits suche ich gern nach Hinweisen in anderen Blasen. Die Studienarbeit zwingt mich dann zum Hinterfragen, Verdichten, Belegen und vernetztem Weiterdenken parallel verlaufender Trends. Meine Hypothesen schärfe ich durch meine Beratungskunden, Reisen, Besichtigungen, Konferenzen, Gremienarbeit, Recherchen und der Auswertung wissenschaftlicher Studien. Zur Beschreibung der Veränderung interviewe ich ausgewählte Experten und Wissenschaftlerinnen aus der KI- und Software-Entwicklung, Process-Automation, der Game-Entwicklung, Neurowissenschaft, UX- und Lernpädagogik, Kreativszene, Architektur- und Raumplanung, Verhaltensforschung und Kollegen aus speziellen Segmenten der Unternehmensberatung. Als Pionier Case oder zum Reality-Check adressiere ich Start-ups, die KI für Unternehmensprozesse entwickeln, oder Unternehmen, die KI strategisch in all ihre Prozesse einbinden. Die Learnings dieser Vorreiterunternehmen mögen auch als Handlungsempfehlung gelten.
Birgit, vielen Dank für das Gespräch.