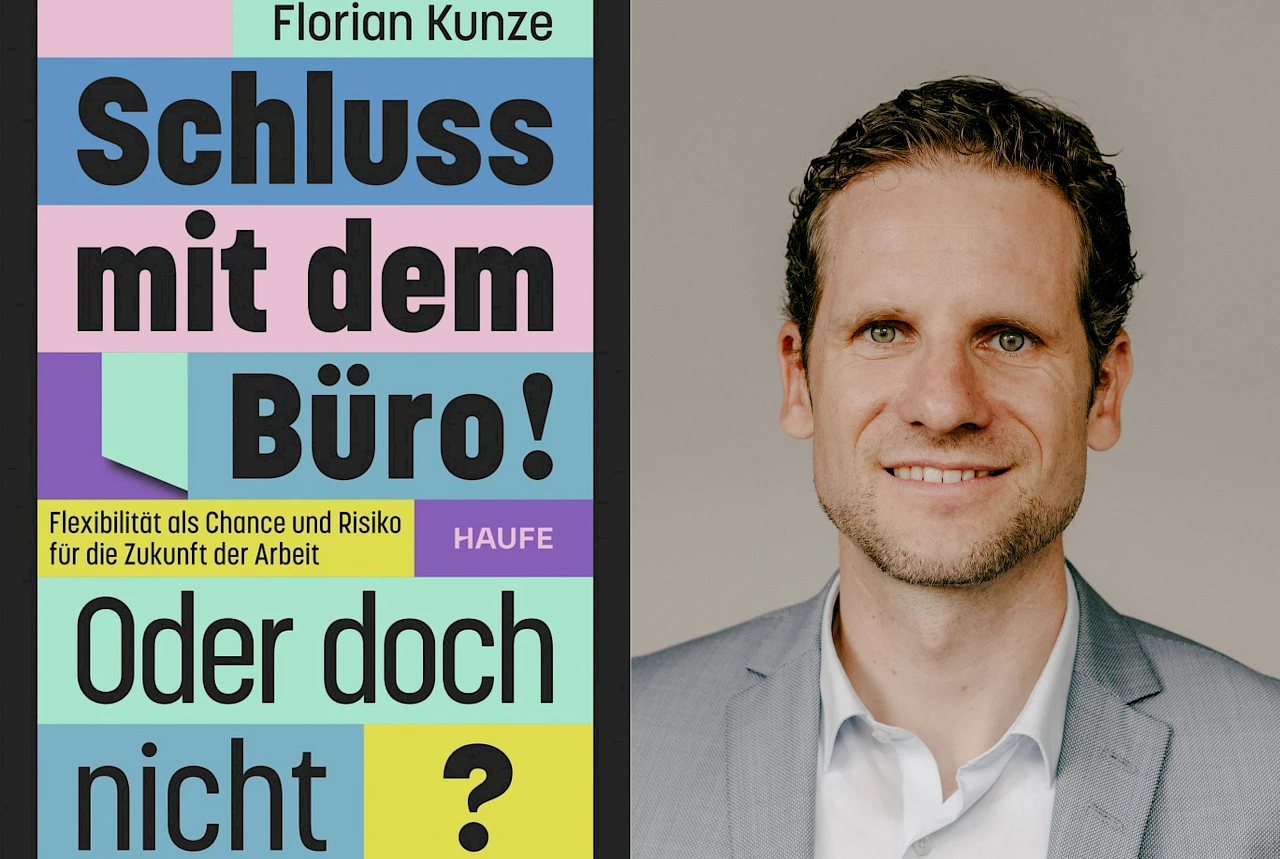Wie gelingt New Work jenseits von Schlagworten? Im Gespräch mit dem IBA Forum erklärt Prof. Dr. Florian Kunze, Leiter des Future of Work Lab an der Universität Konstanz, welche Entwicklungen die Arbeitswelt derzeit prägen, warum Büros als soziale Infrastruktur wichtig bleiben und warum Vertrauen heute wichtiger ist als Technologie.
Herr Professor Kunze, Sie leiten das Future of Work Lab in Konstanz. Woran forschen Sie?
Wir untersuchen, wie große gesellschaftliche und technologische Entwicklungen in Organisationen ankommen. Demografische Veränderungen, Digitalisierung, Wertewandel – all das findet letztlich in Teams und Führungsbeziehungen statt. Uns interessiert, wie sich diese Dynamiken auf Produktivität, Gesundheit und Zusammenarbeit auswirken. Neben internationaler Forschung liegt uns besonders der Austausch mit der Praxis am Herzen.
Welche Dynamiken prägen den Wandel am stärksten?
Drei Faktoren wirken derzeit besonders stark zusammen: Erstens der demografisch bedingte Fachkräftemangel. Zweitens die seit der Pandemie etablierte Flexibilisierung von Arbeitszeit und ‑ort. Und drittens die rapide Einbindung von Künstlicher Intelligenz. Diese Kombination erzeugt Spannungen: Unternehmen müssen einerseits ihre Talente halten, andererseits sich technologisch neu erfinden. Das verlangt eine feinere Steuerung als starre Vorgaben von oben.
Viele Firmen diskutieren momentan eine Rückkehrpflicht ins Büro. Was zeigen Ihre Studien?
Die Entweder-oder-Debatte greift zu kurz. Produktivität hängt weniger vom Ort als von der Qualität der Abstimmung im Team ab. Es gibt Situationen, in denen physische Nähe kreative Prozesse wie auch das Onboarding erleichtert, und andere, in denen konzentriertes, ortsunabhängiges Arbeiten zu Leistungsgewinnen führt. Erfolgreiche Teams treffen ihre Absprachen gemeinsam, statt zentral gesteuert zu werden. Ein transparenter Entscheidungsprozess stärkt die Akzeptanz weitaus mehr als eine Präsenzpflicht.
Welche Bedeutung hat das Büro in einer hybriden Arbeitswelt?
Büros sind nicht nur Orte der Leistungserstellung, sondern auch der sozialen Infrastruktur. Hier entstehen Vertrauen, informeller Austausch und Lerngelegenheiten. Das ist digital nur bedingt reproduzierbar. Gut gestaltete Büros hingegen ermöglichen sie. Präsenz bekommt wieder Bedeutung, wenn sie einen klaren Zweck erfüllt. Dazu gehört auch, Räume so zu gestalten, dass sie Begegnung erleichtern, statt ausschließlich Platz zu bieten.
Flexibles Arbeiten verändert auch das körperliche und mentale Wohlbefinden. Wo bestehen Risiken?
Studien zeigen, dass sich Menschen im Homeoffice im Schnitt weniger bewegen. Hinzu kommen ergonomische Defizite, denn der Küchentisch ersetzt selten einen professionellen Arbeitsplatz. Unternehmen sollten ihre Mitarbeitenden daher stärker unterstützen, beispielsweise mit klaren Leitlinien, Zuschüssen oder Leihmodellen für eine Homeoffice-Ausstattung sowie regelmäßigen Gesundheits-Check-ups im Team. Dabei geht es nicht um Kontrolle, sondern um die langfristige Erhaltung von Leistungsfähigkeit und Resilienz.
Wie führen Sie Ihr eigenes Team?
Wir arbeiten mit hoher Eigenverantwortung. Ein fester Präsenztag pro Woche schafft Struktur, ansonsten gilt: Arbeiten, wo man am effektivsten ist. Für mich bedeutet Führung, zu orchestrieren statt zu dirigieren. Das heißt, Orientierung zu geben, Kommunikation zu rhythmisieren und Entscheidungen zu dokumentieren. So entstehen Verlässlichkeit und Vertrauen, auch ohne permanente Anwesenheit.
Werfen wir einen Blick auf die Rolle von KI. Disruption oder Hype?
Die Disruption ist real, aber nicht neu. Historisch betrachtet haben Arbeitsmärkte immer eine hohe Anpassungsfähigkeit bewiesen. Der Unterschied liegt dieses Mal in der Geschwindigkeit. KI kann Routinen übernehmen, sollte aber den Menschen stärken. In Teams, die KI gemeinsam klug einsetzen, beobachten wir eine höhere Qualität von Entscheidungen und eine höhere Effizienz. Der Schlüssel liegt in der Qualifizierung: Mitarbeitende müssen die Technologie verstehen, hinterfragen und mitgestalten können.
Welche konkreten Handlungsfelder sehen Sie für Unternehmen?
Organisationen sollten Hybridarbeit differenziert steuern und Präsenz nicht dogmatisch, sondern aus der Aufgabenlogik heraus planen. Büros sollten als Orte der Interaktion konzipiert werden, an denen es klare Anlässe für Austausch und Lernen gibt. Zweitens brauchen Gesundheit und Ergonomie feste Strukturen, von Bewegungspausen bis zu Beratungsangeboten. Führungskräfte müssen lernen, hybride Teams zu begleiten, etwa durch regelmäßige Reviews und Feedbackformate. Schließlich sollten KI-Kompetenzen systematisch aufgebaut werden – von Grundlagentrainings bis zu praxisnahen Playbooks. Wichtig ist, Lernen als Teil des Arbeitsalltags zu verstehen und nicht als Zusatzbelastung.
Wie verändert Flexibilisierung die Städte und das Zusammenleben?
Wir beobachten eine deutliche Dezentralisierung: Während Innenstädte an Frequenz verlieren, gewinnen Randbezirke und Wohnquartiere an Bedeutung. Dies hat Auswirkungen auf Stadtplanung, Mobilität und soziale Routinen. Gleichzeitig steigt das Risiko sozialer Isolation, insbesondere bei jungen Menschen. Unternehmen sind daher auch Orte gesellschaftlicher Teilhabe. Reale Begegnungen und Gemeinschaftsräume sind entscheidend, um Bindungen zu fördern und die mentale Gesundheit zu erhalten.
Was ist Ihr Fazit nach fast zehn Jahren Forschung an der Zukunft der Arbeit?
Technologie verändert Strukturen, Vertrauen prägt Kultur. Die Zukunft der Arbeit wird dort erfolgreich sein, wo technologische Innovation auf menschliche Bindung trifft. Führung, die Sinn vermittelt, psychologische Sicherheit bietet und Lernräume eröffnet, wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Dafür benötigen wir weniger Ideologie, aber mehr Evidenz und den Mut, hybride Zusammenarbeit aktiv zu gestalten. In meinem neuen Buch schlage ich die Brücke zwischen Forschung und Praxis, bündele zentrale Studien und stelle konkrete Routinen für den Arbeitsalltag vor.
Herr Professor Kunze, vielen Dank für das Gespräch.