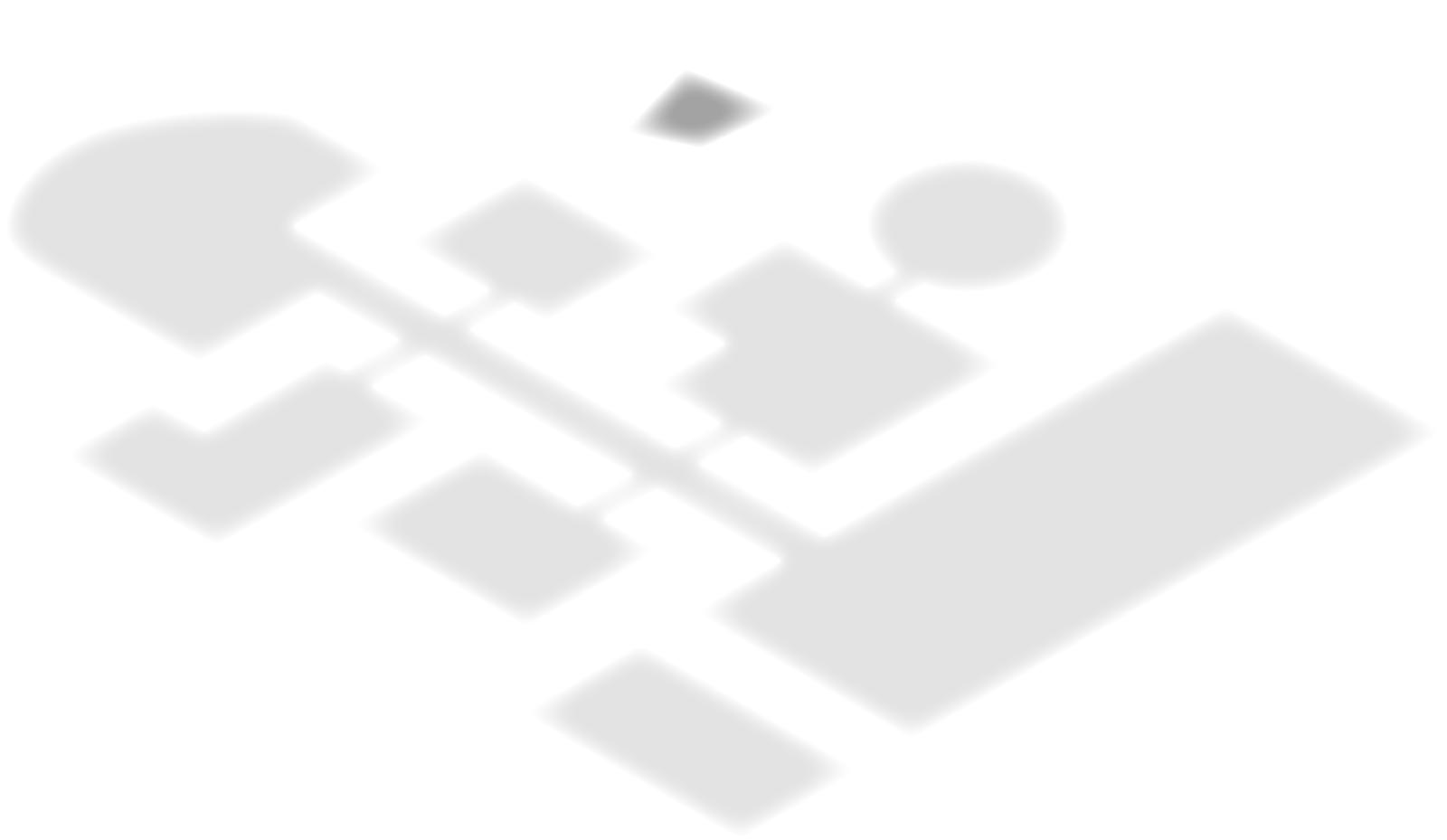Wie lässt sich der Wandel der Arbeitswelt räumlich gestalten? Welche Rolle spielt Co-Working in einer Zeit, in der Flexibilität, Nutzungsvielfalt und Lebensqualität immer wichtiger werden? Für Maarten Jamin ist die Antwort klar: Die Zukunft der Arbeit liegt in geteilten Modellen. In seinem Vortrag auf dem Work Culture Festival plädierte der Chief Design Officer bei IWG und Mitgründer des niederländischen Kreativkollektivs bs;bp für ein radikal erweitertes Verständnis von Co-Working: nicht als Schreibtisch-Sharing, sondern als Plattform für Community, Context, Cooperation und Co-Existence. Anhand konkreter Beispiele zeigte er, wie diese Prinzipien Architektur, Stadtentwicklung und Unternehmenskultur verändern könnten.
Drei Typen, ein Gedanke: Teilen schafft Mehrwert
Co-Working ist vielfältiger geworden und genau darin liegt seine Stärke. Maarten Jamin unterscheidet drei wesentliche Ausprägungen, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen, aber alle auf dem Prinzip des Teilens basieren.
Beim Corporate Co-Working gestalten Unternehmen ihre eigenen Büroflächen als offene, gemeinschaftsorientierte Arbeitsumgebungen um. Neben einer effizienteren Flächennutzung geht es hier vor allem darum, den Standort als sozialen Ort aufzuwerten und die interne Zusammenarbeit zu fördern.
Das Multi-Tenant Co-Working bringt Selbstständige, Start-ups und etablierte Unternehmen unter einem Dach zusammen. Die gemeinsam genutzten Räume bieten ökonomische Vorteile, aber auch die Chance auf zufällige Begegnungen, neue Kooperationen und gegenseitige Inspiration, sofern die Räume entsprechend gestaltet sind und das Miteinander aktiv moderiert wird.
Stand-alone Co-Working Spaces bieten wiederum wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten als dritte Orte, jenseits von Büro und Zuhause. Sie reduzieren Pendelzeiten, erhöhen die Lebensqualität und stärken lokale Nachbarschaften. Oft sind sie in Quartierskonzepte eingebunden, die eine Mischnutzung berücksichtigen, und wirken als Impulsgeber für die Belebung der Umgebung.
Was all diese Modelle verbindet, ist eine Haltung: Arbeit wird nicht länger an Besitz, sondern an Zugang geknüpft. Co-Working steht somit exemplarisch für eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu Sharing-Ökonomie, Ressourceneffizienz und sozialer Teilhabe.
Vom Arbeitsplatz zur Nutzungsplattform
Der wirtschaftliche Druck auf den Immobilienmarkt beschleunigt diese Entwicklung. Angesichts steigender Leerstände und sinkender Büroauslastung suchen Eigentümer nach neuen Konzepten. Jamin spricht offen über die „Angst in der Branche“: Viele Immobilien verlieren an Marktwert, weil klassische Nutzungsmuster nicht mehr greifen. Co-Working bietet hier die Möglichkeit, Flächen flexibel zu nutzen und weiter zu monetarisieren. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen der Nutzer. Anstelle von „9 to 5“-Arbeitsplätzen werden inspirierende Umgebungen gesucht, die Lebensqualität und Flexibilität vereinen. Die Folge: Co-Working-Flächen müssen heute viel mehr sein als nur funktionale Arbeitsorte. Sie sind Plattformen für Austausch, Lernen, Services und soziale Interaktion.
Lesen Sie auch

Mixed Use als Zukunftsmodell
Ein Ansatz, der in der Diskussion um zukunftsfähige Arbeitsformen zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die gemischte Nutzung von Gebäuden. Maarten Jamin stellte in seinem Vortrag internationale Beispiele vor, bei denen Co-Working bewusst mit anderen Funktionen verknüpft wird, wie etwa Markthallen mit integrierten Büroflächen, Wohngebäude mit öffentlich zugänglichen Arbeitslounges oder Cafés mit angeschlossener Kinderbetreuung und Fahrradwerkstatt. Ein besonders anschauliches Beispiel stammt aus dem Londoner Stadtteil Peckham. Dort wurde ein ganzes Gebäude so konzipiert, dass es Gastronomie, Veranstaltungsflächen, Arbeitsplätze und Wohneinheiten unter einem Dach vereint, um eine Nutzung rund um die Uhr zu ermöglichen. Der Grundgedanke dabei ist, dass anstelle monofunktionaler Immobilien multifunktionale Orte entstehen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren können. Solche Konzepte steigern die wirtschaftliche Auslastung und die gesellschaftliche Relevanz eines Standorts. Wo Arbeiten, Lernen, Kultur, Nahversorgung und Nachbarschaft aufeinandertreffen, entsteht ein lebendiges Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität. Für Planer bedeutet das: Zukunftsorientierte Architektur denkt über den einzelnen Arbeitsplatz hinaus und beginnt bereits im Grundriss mit der Idee einer vielfältigen Nutzung.
Flexibilität braucht Struktur
Doch wie lässt sich das in der Praxis umsetzen? Jamin plädiert für eine neue Generation von Raumkonzepten, die maximale Wandelbarkeit zulassen, ohne beliebig zu werden. Er nennt dies das Prinzip der „unsichtbaren Linien auf dem Boden“: klare Raster, modulare Möbel und adaptive Grundrisse, die sich je nach Bedarf schnell umnutzen lassen. Vom Einzelbüro zur Lernlounge, vom Meetingraum zur Ausstellung. In kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen. Wichtig ist dabei eine intelligente Grundstruktur, die Orientierung bietet und Veränderungen unterstützt, ohne dass jedes Mal bauliche Maßnahmen notwendig sind. Ein Beispiel ist das Vitra Koma-System, mit dem sich Räume innerhalb eines Tages komplett neu organisieren lassen. „Wie ein Lego-Set mit Anleitung“, so Jamin. Ein Baukastenprinzip für die Raumgestaltung, das die Nutzer dazu befähigt, ihre Umgebung selbst aktiv zu gestalten. Diese Selbstermächtigung ist von wesentlicher Bedeutung: Wer seine Umgebung flexibel an die eigene Arbeitsweise anpassen kann, fühlt sich nicht nur wohler, sondern auch ernst genommen. Flexibilität wird so zur kulturellen und räumlichen Qualität und ist eine Einladung zur Teilhabe und Mitverantwortung. Jamin betont: „Die Zukunft gehört nicht statischen Raumprogrammen, sondern dynamischen Nutzungslogiken.“ Räume müssen nicht für einen Zweck perfekt sein, sondern für viele Zwecke gut genug und leicht veränderbar sein. Dazu braucht es keinen technischen Overkill, sondern ein durchdachtes Zusammenspiel von Design, Funktionalität und Nutzerführung.
Co-Working als Community-Aufgabe
Damit diese Räume nicht zu anonymen „Schreibtisch-Tankstellen“ verkommen, braucht es mehr als nur gutes Design. Co-Working funktioniert nur dann nachhaltig, wenn es als soziale Infrastruktur konzipiert und betrieben wird. Jamin betont: „Architektur kann den Rahmen setzen – mit offenen Zonen, Begegnungsflächen und identitätsstiftenden Materialien.“ Doch erst das, was zwischen den Menschen passiert, macht den Ort lebendig. Es braucht Community-Management, das nicht nur organisiert, sondern auch inspiriert. Es braucht Menschen vor Ort, die Programme kuratieren, Netzwerke fördern und gezielt den Austausch ermöglichen. Formate wie Frühstücksrunden, TED-Talks, After-Work-Sessions oder Pop-up-Ausstellungen schaffen nicht nur Abwechslung, sondern senken auch die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme. Sie verwandeln zufällige Nähe im geteilten Raum in tatsächliche Verbindungen. Das ist besonders in Multi-Tenant-Kontexten entscheidend, in denen die Nutzer aus völlig unterschiedlichen Branchen und Hintergründen kommen. Der Mensch am Nachbartisch ist zwar kein Kollege, aber vielleicht ein zukünftiger Partner oder Kunde und auf jeden Fall ein spannender Gesprächspartner.
Deshalb erfordert Co-Working eine Kultur des Teilens, Zuhörens und Mitgestaltens. Offenheit, Vertrauen und Neugier sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen gezielt gefördert und gepflegt werden. Das „Co“ im Co-Working steht somit für Collaboration, Community, Context und Co-Creation. Es ist kein Nebenaspekt, sondern der zentrale Auftrag an alle, die solche Orte entwickeln und betreiben.