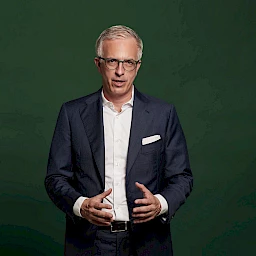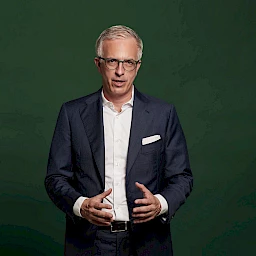Die Kolumne für das IBA Forum von Dr. Daniel Dettling, einem der profiliertesten Zukunftsdenker im deutschsprachigen Raum, beschäftigt sich im Oktober 2025 mit dem „Future Hangover“ in Deutschland – der gesellschaftlichen Erwartungskrise nach Dekaden des Fortschrittsglaubens, dem Wandel der Zukunftsbilder und der Notwendigkeit, Zukunftskompetenz neu zu entwickeln.
Dreiviertel der Deutschen ziehen ein sicheres Leben in bescheidenem Wohlstand gegenüber einem riskanten mit vielen finanziellen Chancen vor, so eine aktuelle Befragung. Die Botschaft: „Veränderung ist zwecklos“. Auch diesmal wird es anders kommen als viele denken und prognostizieren. Der Weg zu einem neuen deutschen Lebensgefühl ist kürzer als heute viele vermuten. Der Publizist Tom Junkersdorf schildert das real existierende Lebensgefühl unserer Tage in der Zeitschrift Tomorrow als „Post Future Hangover“, als Zukunfts-Verkaterung:
„Wir alle haben offenbar einen Kater. Aber es geht nicht nur um eine Krankheit, sondern um das, was wir Leben nennen. Wir haben uns auf den Fortschritt gefreut. Die Technik. New Work. Die Chance auf Homeoffice, neue Werte und neue Wertschöpfung. Wir haben die Digitalisierung umarmt wie gute Gastgeber. Jetzt haben wir all das. Und spüren, dass es unserer Lebensqualität und unserem Wohlbefinden nicht besser geht. Wir wollten Wellbeing und haben plötzlich Toxic Care. Wir wollten Wohlstand und haben plötzlich Notstand überall. Wie wollten Frieden und haben plötzlich Krieg.“
Raus aus der Erwartungskrise
Zukunft und Fortschritt werden nicht mehr als glückliche Utopie gesehen. Statt Work-Life-Balance, Klimaschutz, Künstliche Intelligenz, Migration, New Work und die Verheißung einer neuen Wirtschaft, die Wohlstand und Wohlfühlen für alle bringt, wurden Überforderung und Ernüchterung. Die Folgen sind Enttäuschung, Resignation, Unsicherheit oder gar Wut und Hass. Das Spannungsverhältnis zwischen Hoffnung und Handlungsmacht wird zu groß. Die Realitäten sind komplexer als wir angenommen haben. Wie kommen wir aus der Komplexitätsfalle wieder heraus und lassen den Zukunftskater hinter uns? Indem wir den Umgang mit Ent-Täuschungen lernen und uns pragmatische Ziele setzen.
„Die heutige Omnikrise ist vor allem eine Erwartungskrise“, so der Zukunftsforscher Matthias Horx. „Eine Steigerungskrise: Wir haben von der Zukunft viel erwartet.“ So viel, dass wir gar nicht merkten, wie sich überall Paradoxien und Widersprüche auftürmten. Was wir verloren haben, ist die Vorstellung, dass die Welt trotz allem besser wird. Was uns abhanden gekommen ist, ist Zukunftskompetenz, „Future Literacy“ als die Fähigkeit, sich nicht von Problemen vereinnahmen zu lassen, sondern sie von den Lösungen her zu sehen und kreativ und resilient auf sie zu reagieren. Individuell, gesellschaftlich und unternehmerisch.
Zukunftskompetenz gehört auf die Agenda von Schulen, Unternehmen und Politik. Der „Lehrplan“ umfasst eine offene Lern- und Fehlerkultur, psychologische Sicherheit, Empathie, Veränderungsbereitschaft und Ambiguitätstoleranz als Fähigkeit, mit Unklarheit und Widersprüchen umzugehen und ruhig und handlungsfähig zu bleiben.
Wandel bedeutet nicht immer gleich Fortschritt, sondern vor allem Veränderung. Vielleicht leben wir in einer neuen, prototypischen Aufbruchszeit, ohne es zu merken. Auch wenn es paradox klingen mag: Es ist grundvernünftig, gerade jetzt mutig zu denken, zu handeln – und zu entscheiden. Nur dann verharren und erstarren wir nicht in Angst, sondern können uns und die Welt um uns herum weiterentwickeln. Das Bessere ist dann das weniger Schlimme oder die Vermeidung des Allerschlimmsten.
Wie macht man die Welt wieder frisch?
Mutige, auch riskante Entscheidungen zu treffen, etwas Neues auszuprobieren das war noch nie so einfach wie heute. Zum einen zählen die Maßstäbe der Vergangenheit immer weniger, zum anderen stehen uns in der heutigen Gesellschaft mehr Möglichkeiten denn je offen. Um sie zu nutzen, braucht es frisches Denken und den Mut, Neues zu wagen: Zuversicht im Umgang mit Unsicherheit und Risiko, eine positive Sicht auf Veränderungen und Dynamiken. Der Philosoph Zygmunt Bauman hatte in seinem ganzen Leben nur eine zentrale Frage: „Wie macht man die Welt wieder frisch?“ Bauman verstand darunter die Fähigkeit, die Welt staunend und neugierig immer wieder neu zu betrachten und nach vorne zu denken.
Das Neue kommt in Wahrheit von innen, aus der Beziehung zur Welt, zu Technologien und zu sich selbst. Zukunft und Zuversicht entstehen, wenn wir unsere Zukunftsenttäuschung nicht als End‑, sondern als Startpunkt für Verbesserungen und neue Optionen betrachten. Es geht nicht um einfache Antworten, es geht um neue Perspektiven, Beziehungen und das aktive Aushandeln von Zukunft.
Dr. Daniel Dettling ist Zukunftsforscher und Gründer des Instituts für Zukunftspolitik (www.institut-zukunftspolitik.de). Dort erschien vor Kurzem das Buch „Eine bessere Zukunft ist möglich – Ideen für eine Welt von morgen“.
Titelbild: Dr. Daniel Dettling (Foto: Laurence Chaperon)




 IBA Forum-Gastbeitrag
IBA Forum-Gastbeitrag