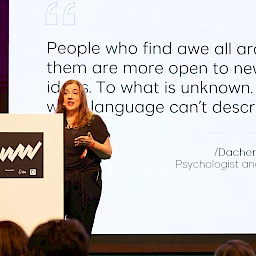Beim Work Culture Festival wurde ein aktuelles Thema diskutiert: Welche Rolle spielt das Büro in einer Arbeitswelt, die zunehmend von hybriden Modellen geprägt ist? Unter dem Titel „Identitätskrise: Muss es das Büro allen recht machen?“ beleuchtete ein Panel mit Uli Blum, Marnix Mali, Valeria Segovia und Vaughn Tan unter der Moderation von Robert Thiemann die Knackpunkte moderner Arbeitsräume.
Flexibilität statt Zwangsrückkehr
Eines der Kernthemen war die Flexibilität. Die Panelteilnehmer waren sich einig: Die Forderung „Zurück ins Büro an fünf Tagen der Woche“ ist nicht mehr zeitgemäß. Gerade die Erfahrungen aus der Pandemie hätten gezeigt, dass Produktivität nicht an die Präsenz im Büro gekoppelt ist. Stattdessen profitieren sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter von hybriden Modellen, die Selbstbestimmung und Anpassung an individuelle Lebenssituationen erlauben. Marnix Mali betonte, dass Booking.com eine Empfehlung von zwei Präsenztagen pro Woche ausspreche, dies jedoch keine Pflicht sei. „Wir wissen, dass erwachsene Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, unabhängig davon, ob sie im Büro oder zu Hause sitzen“, erklärte er. Eine solche Autonomie fördere Vertrauen und steigere die Motivation.
Kulturelle Aspekte und Generationenfragen
Das Panel beleuchtete auch die Rolle des Büros als kulturellen Treffpunkt. Insbesondere junge Mitarbeiter, die während der Pandemie ins Berufsleben gestartet sind, benötigen physische Präsenz, um von Kollegen zu lernen. Segovia unterstrich: „Virtuelle Zusammenarbeit kann viel, aber das beiläufige Lernen durch Beobachten und Zuhören ist online schwerer zu realisieren.“ Die Diskutanten warnten zudem vor einem Missverständnis, das in einigen Unternehmen zu herrschen scheint: Wer Mitarbeiter zur Rückkehr zwingt, verliert nicht nur Vertrauen, sondern möglicherweise auch Talente. Flexibilität ist inzwischen ein entscheidendes Kriterium im Wettbewerb um die klügsten Köpfe: „Büros müssen einen echten Mehrwert bieten, damit die Leute gerne kommen“, so Mali.
Diverse Räume für diverse Bedürfnisse
Ein weiteres Thema war die Gestaltung von Büroräumen. „Das Büro sollte so divers wie möglich gestaltet sein“, forderte Uli Blum. Klassische Großraumbüros seien nicht länger die beste Lösung. Es brauche stattdessen ein breites Angebot an Räumen: von stillen Rückzugsorten für konzentriertes Arbeiten bis hin zu offenen Bereichen, die Zusammenarbeit und Kreativität fördern. Besonders spannend war die Beobachtung, dass die Persönlichkeitstypen – introvertiert oder extrovertiert – oft stärker über Raumpräferenzen entscheiden als die Abteilung oder der Arbeitsbereich. Mali berichtete von einem Experiment bei Booking.com, bei dem sich zeigte, dass introvertierte Mitarbeiter häufig Rückzugsmöglichkeiten bevorzugen, während andere offene, kommunikative Bereiche suchen. Eine persönlichkeitsbasierte Raumgestaltung sei deshalb ein wichtiger Schlüssel.
Räume werden anders genutzt als geplant
Die Panelteilnehmer berichteten, dass die Nutzung von Büroräumen selten den ursprünglichen Vorstellungen der Architekten entspricht. „Die Menschen machen die Räume zu dem, was sie brauchen“, erklärte Valeria Segovia. Dieser Prozess erfolgt meist spontan und hängt stark von den jeweiligen Arbeitsanforderungen ab. So werden Lounge-Bereiche, die eigentlich für informelle Pausen vorgesehen sind, gern zu produktiven Arbeitszonen oder für kleine Meetings genutzt. Selbst Kantinen oder Cafés verwandeln sich in Kommunikations-Hubs, weil die Mitarbeiter die Atmosphäre als inspirierend empfinden. Das bedeutet, dass ein Büro nicht starr in Arbeiten und Pausieren unterteilt sein sollte. Vielmehr braucht es ein modulares, anpassbares Konzept, das mehrere Funktionen ermöglicht. Flexible Möbel, mobile Trennwände oder multifunktionale Räume sind daher zentrale Gestaltungselemente. Uli Blum betonte zudem, dass Räume als offene Systeme geplant werden sollten, die eine gewisse Unschärfe erlauben und somit bewusst nicht zu sehr auf eine einzige Aktivität zugeschnitten sein sollten. Diese Offenheit gibt den Nutzern die Freiheit, Räume kreativ zu interpretieren und sie im Alltag so zu nutzen, wie es ihnen am meisten hilft. Diese Erfahrung hat man auch bei Booking.com gemacht, wie Marnix Mali berichtete: Manche Zonen, die ursprünglich als stille Arbeitsbereiche konzipiert wurden, haben sich im Laufe der Zeit zu Treffpunkten entwickelt, während bestimmte Meetingräume eher von Einzelpersonen genutzt werden, um konzentriert zu arbeiten. Der entscheidende Erfolgsfaktor liege darin, solche Veränderungen zuzulassen, zu beobachten und das Raumkonzept dynamisch anzupassen. „Ein Büro ist nie fertig. Es entwickelt sich mit seinen Nutzern immer weiter“, fasste Mali zusammen.
Lernende Büros: Sensorik und KI
Einen interessanten Ausblick gaben die Experten beim Thema „Lernendes Büro“. Demnach könnten Sensorik, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz in naher Zukunft eine zentrale Rolle spielen, um Arbeitsräume intelligent und flexibel zu gestalten. Uli Blum sprach von der Vision selbstlernender Räume, die auf Basis des Nutzerverhaltens und von Feedback eigenständig Anpassungen vornehmen. Beispielsweise könnten Sensoren erkennen, wie stark bestimmte Zonen genutzt werden, ob Räume eher für ruhiges Arbeiten oder spontane Meetings beansprucht werden. Entsprechend könnten sie die Gestaltung oder Raumzuteilung dynamisch anpassen. KI-basierte Systeme könnten Vorschläge machen, um Räume besser auszulasten oder Konfigurationen zu optimieren – etwa durch die automatische Anpassung von Beleuchtung, Akustik oder Möblierung. Blum betonte, dass diese Technologie kein Selbstzweck sei, sondern ein Werkzeug, um Büros langfristig attraktiver zu machen: „Wir müssen Räume entwickeln, die sich verändern können, so wie sich auch unsere Arbeitsgewohnheiten verändern.“ Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur eine effizientere Flächennutzung, sondern auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, da ihre Bedürfnisse kontinuierlich berücksichtigt würden. Gerade in Zeiten des schnellen Wandels könne ein adaptives Büro ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.
Partizipation als Schlüssel
Mindestens genauso wichtig wie intelligente Technologie ist die aktive Einbindung der Mitarbeiter in den Gestaltungsprozess. Vaughn Tan wies darauf hin, dass ein Büro nur dann Akzeptanz findet, wenn die zukünftigen Nutzer von Beginn an gehört werden. „Nur wer von Anfang an beteiligt wird, wird sich später mit dem Raum identifizieren“, so Tan. Dieser partizipative Ansatz bedeutet nicht nur, Wünsche und Feedback abzufragen, sondern auch, die Menschen in Experimentierphasen einzubinden. Marnix Mali berichtete von einem Pilotprojekt bei Booking.com, bei dem verschiedene Raumkonzepte mit realen Teams getestet wurden. „Die Erkenntnisse aus diesen Tests waren oft anders als erwartet. Erst das Feedback der Nutzer hat gezeigt, was wirklich funktioniert.“ Partizipation bedeutet auch, kontinuierlich zuzuhören – nicht nur in der Planungsphase, sondern während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Mithilfe von Feedbackschleifen, regelmäßigen Umfragen und offenen Dialogformaten kann die Arbeitsumgebung fortlaufend optimiert werden.
Ausblick: Das Büro als Begegnungsraum
Das Panel machte deutlich, dass das Büro in Zukunft nicht mehr nur als Ort des konzentrierten Arbeitens verstanden werden kann. Vielmehr entwickelt es sich zu einem Raum der Begegnung, des Austauschs und der Kreativität. Physische Zusammenarbeit bleibt ein wichtiger Bestandteil moderner Arbeitskultur und muss durch entsprechend attraktive Rahmenbedingungen unterstützt werden. Dabei ist nicht nur die räumliche und technische Ausstattung entscheidend, sondern vor allem ein Kulturwandel: Unternehmen müssen Arbeitsumgebungen als lebendige Systeme begreifen, die sich stetig an die Bedürfnisse der Menschen anpassen und gleichzeitig Gemeinschaft und Identifikation fördern.