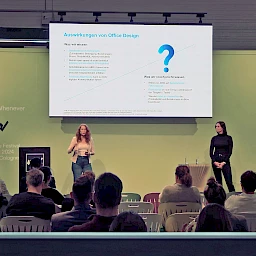Was kann KI wirklich leisten? Und wie lassen sich Technologie und Menschlichkeit sinnvoll verbinden? Beim Panel „Vom KI-Hype zur Realität“ auf dem Work Culture Festival diskutierte der Digitalisierungsexperte Prof. Dr. Herbert Schuster mit Julia Schmid und Andreas Stieglbauer von Drees & Sommer darüber, wie KI-Arbeitsweisen konkret aussehen können – und was Unternehmen dabei beachten sollten.
Mehr als ein Hype: KI ist gekommen, um zu bleiben
Einig waren sich die Experten in ihrer Einschätzung der aktuellen Situation: Der anfängliche Hype um KI ist einer sachlichen, zunehmend strategischen Auseinandersetzung gewichen. „Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Trends erlebt. Aber diesmal ist es größer“, betonte Prof. Dr. Herbert Schuster. Künstliche Intelligenz sei längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr, sondern im Alltag der Menschen angekommen. Tools wie ChatGPT hätten eine breite gesellschaftliche Relevanz erreicht und sorgten für einen Wow-Effekt, der mit früheren Technologieschüben kaum vergleichbar sei. Auch im Unternehmenskontext sei die Dynamik spürbar. Prozesse verändern sich, ganze Berufsbilder wandeln sich – und damit auch die Erwartungen an Mitarbeiter und Führungskräfte. KI werde nicht verschwinden, sondern ihre Rolle in der Arbeitswelt weiter ausbauen. Die Panelteilnehmer waren sich sicher: Wer heute über Arbeitskultur spricht, kommt an der Frage nach dem Einsatz von KI nicht mehr vorbei. Die Frage sei nicht mehr, ob KI kommt, sondern wie sie sinnvoll integriert werden kann.
Neue Arbeitsweisen durch KI: Zwischen Effizienz und Empowerment
Julia Schmid berichtete aus der Praxis bei Drees & Sommer: „Wir nutzen KI, um komplexe Anforderungen in der Gebäudeplanung zu analysieren und Prozesse datenbasiert zu optimieren.“ Ihr internes Corporate Venture „formfollows.ai“ entwickelt intelligente Anwendungen, die aus Nutzeranforderungen, Flächenparametern und Betriebsdaten automatisiert Vorschläge für Raumkonzepte generieren. Der Mehrwert: Planer werden von zeitaufwendigen Analyse- und Routineaufgaben entlastet und gewinnen Raum für kreative, gestalterische und strategische Entscheidungen. Andreas Stieglbauer bestätigte diese Entwicklung: „Wir erleben einen grundlegenden Wandel – nicht nur in der Art, wie Software entwickelt wird, sondern auch in der Art, wie Entscheidungen getroffen werden.“ Innerhalb kürzester Zeit hätten sich Standards und Erwartungen verschoben: Was früher ein komplexer Planungsprozess war, könne heute mit wenigen Klicks vorbereitet und simuliert werden. Der Anspruch an Präzision und Individualisierung steige, gleichzeitig nehme das Tempo zu. Genau hier könne KI eine Brücke schlagen zwischen technischer Exzellenz und menschlichem Gespür für den richtigen Weg.
Der Mensch bleibt im Mittelpunkt
Bei allen technologischen Möglichkeiten war sich das Panel einig: Im Mittelpunkt jeder KI-Anwendung muss der Mensch stehen. „Human in the loop“, also der Mensch als aktiver Teil der Entscheidungskette, sei unverzichtbar, betonte Julia Schmid. Es gehe nicht darum, menschliche Entscheidungen durch Maschinen zu ersetzen, sondern um eine intelligente Ergänzung, bei der die Technik den Menschen unterstützt und stärkt. Gerade im Change-Management sei es wichtig, die Mitarbeiter frühzeitig einzubinden, sie zu befähigen und ihnen aktiv Gestaltungsspielräume zu eröffnen. Auch Prof. Dr. Schuster plädierte für eine bewusste Herangehensweise: Nur weil KI bestimmte Aufgaben übernehmen könne, heiße das nicht, dass sie dies immer tun müsse. In manchen Fällen sei es sinnvoller, Prozesse bewusst beim Menschen zu belassen – etwa wenn sie zur Identifikation mit dem Unternehmen beitragen oder Motivation und Sinnstiftung fördern. Technologie soll den Menschen nicht ersetzen, sondern befähigen. Ein wertschätzender Umgang mit menschlicher Leistung bleibe auch im Zeitalter der Automatisierung unverzichtbar. Letztlich, so die einhellige Meinung, gehe es nicht nur um Effizienz, sondern auch um Verantwortung.
KI-gestützte Planung: Daten, Design und Dialog
In der Gebäudeplanung und Arbeitsplatzgestaltung trifft Technologie auf Emotion. Die Aufgabe besteht darin, vielfältige Anforderungen zu koordinieren und zu integrieren. „KI kann große Datenmengen analysieren und so helfen, optimale Entwürfe für Büroflächen zu entwickeln. Das ersetzt aber nicht das Gespräch mit den Menschen vor Ort“, betonte Schmid. Es brauche weiterhin den Dialog mit den Nutzern, um Bedarfe zu verstehen und passende Lösungen zu entwickeln. Auch Andreas Stieglbauer verwies auf das Spannungsfeld zwischen Kostendruck, Flächenreduktion und dem Wunsch nach ansprechenden, inspirierenden Arbeitsumgebungen. „Ein gutes Büro kann Anziehungspunkt sein. Aber letztlich kommen die Menschen wegen der Menschen.“ Gerade deshalb werde der Social Space – also Orte der Begegnung, des Austauschs und des informellen Lernens – in der Planung immer wichtiger. Moderne Arbeitswelten müssten heute daher nicht nur funktional, sondern auch emotional anschlussfähig sein. Dies gelinge nur durch einen integrativen Planungsansatz, der datenbasierte Erkenntnisse mit menschlichem Erleben verbindet.
Sozialität, Soft Skills und Veränderung als Chance
KI kann repetitive Tätigkeiten übernehmen – das schafft Raum für das, was Maschinen nicht können: Zwischenmenschliches. Der Austausch, das spontane Gespräch, das gegenseitige Verständnis werden zum echten Mehrwert. „Früher war Smalltalk unproduktive Zeit, heute nennen wir es Socializing und erkennen den Wert für Zusammenarbeit und Kreativität“, so Schuster. Gerade in hybriden Arbeitskontexten sei der soziale Kitt entscheidend für funktionierende Teams und Innovationskraft. Gleichzeitig brauche es einen Mentalitätswandel auf allen Ebenen. „Manche Führungskräfte denken noch in alten Leistungskategorien“, so Stieglbauer. „Ein attraktives Foto des neuen Büros auf LinkedIn reicht aber nicht aus. Es geht um echte Veränderung und Beteiligung.“ Unternehmen müssten den Mut haben, Mitarbeiter aktiv in Veränderungsprozesse einzubinden und neue Formen der Zusammenarbeit zuzulassen. Die Panelteilnehmer waren sich einig: Wer KI im Unternehmen einsetzt, muss nicht nur Technologien integrieren, sondern auch die Menschen mitnehmen. „Wir müssen mit den Mitarbeitern reden: Was nervt euch? Was könnte euch KI abnehmen?“ So könne man auch skeptische Kollegen motivieren, sich auf die neuen Möglichkeiten einzulassen. Wichtig sei ein fairer Deal, so Schuster: „Wenn wir durch KI Zeit gewinnen, sollten wir diesen Gewinn teilen – zum Beispiel durch eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Tag.“
Die Diskussion machte deutlich: KI ist kein Selbstläufer, sondern ein Katalysator für notwendige Veränderungen. Sie stellt bestehende Routinen infrage und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten für effizientere, menschenzentrierte Prozesse. Noch ist nicht alles möglich, aber die Entwicklung schreitet rasant voran. Die Experten zeigten sich optimistisch: „Wir stehen erst am Anfang eines riesigen Möglichkeitsraums. Entscheidend ist nicht, was die Technologie kann, sondern, was wir daraus machen.“
Lesen Sie auch

Andreas Stieglbauer ist Architekt und Associate Partner bei Drees & Sommer. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit der Gestaltung moderner Arbeitswelten. Mit seinem Team unterstützt er Unternehmen und öffentliche Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger Arbeitsplatzkonzepte – stets mit dem Ziel, Funktionalität und emotionale Qualität miteinander zu verbinden. Weitere Informationen: https://www.linkedin.com/in/andreas-stieglbauer-a4034b227/
Julia Schmid ist Spezialistin für Künstliche Intelligenz und digitale Geschäftsmodelle bei Drees & Sommer. Sie ist Teil des unternehmenseigenen Start-ups formfollows.ai und verantwortet dort das Key-Account-Management sowie die nutzerzentrierte Produktentwicklung. Mit ihrem Hintergrund im Innovationsmanagement entwickelt sie datenbasierte Lösungen zur Optimierung von Planungs- und Betriebsprozessen im Gebäudesektor. Weitere Informationen: https://www.linkedin.com/in/julia-schmid-german/
Prof. Dr. Herbert Schuster ist Wirtschaftsinformatiker und Experte für digitale Transformation. Er war unter anderem CIO bei SNP Schneider-Neureither & Partner SE und zuvor Dekan der Fakultät für Informatik an der SRH Hochschule Heidelberg. In den letzten Jahren hatte er verschiedene akademische und beratende Positionen inne, unter anderem an der Hochschule der Wirtschaft für Management, der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) sowie als Executive Advisor bei lumentis ai. Darüber hinaus ist er Aufsichtsratsmitglied der Grieshaber Logistics Group AG. Sein Fokus liegt auf der praxisnahen Verknüpfung von Digitalisierung, Entrepreneurship und Bildung. Weitere Informationen: https://www.linkedin.com/in/prof-dr-herbert-schuster-57651129/
Titelbild: IBA